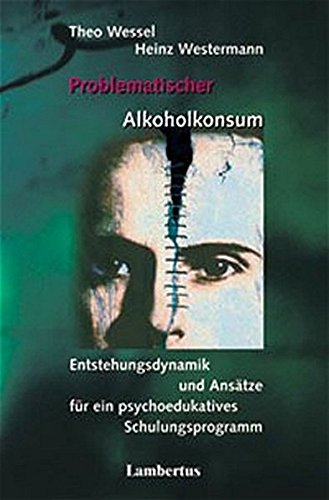Zusammenfassung
Das ambulante Schulungsprogramm “PEGPAK – Psychoedukatives Gruppenprogramm bei problematischem Alkoholkonsum” hat erwachsene Patienten mit problematischem Alkoholkonsum als Zielgruppe. Wichtige Inhalte der Schulung sind: Vermittlung von Informationen über riskanten und problematischen Alkoholkonsum, Erwerb von Fähigkeiten zum Selbstmanagement und zur Selbstkontrolle bei der Erreichung selbst formulierter Ziele (Nullkonsum vs. gesundheitsverträglicher Konsum), Krisenprophylaxe und Krisenplanung. Die Schulung besteht aus 9 Einheiten und ist für eine Gruppe von maximal 15 Teilnehmern konzipiert. Die Durchführung der Schulung obliegt keiner bestimmten Berufsgruppe. Eine Pilotstudie liegt vor. Fortbildungen für Trainer werden angeboten.
| Autoren | Theo Wessel, Heinz Westermann |
| Lizenzhinweise | publiziert |
| Bezugsquelle | Wessel, T. & Westermann, H. (2002). Problematischer Alkoholkonsum – Entstehungsdynamik und Ansätze für ein psychoedukatives Schulungsprogramm. Freiburg: Lambertus. ISBN-10: 3-7841-1445-8 ISBN-13: 9783784114453 |
| Kosten | nur noch gebraucht erhältlich (Stand: November 2023) |
| Schlagworte | – |
| Stand | Version 2002 |
Ziele und Inhalte
| Zielgruppe des Programms | |
|---|---|
| Fachgebiet/Indikation | Psychosomatik |
| Thema/Erkrankung | problematischer Alkoholkonsum |
| Zielgruppe des Programms | Erwachsene |
| besondere Zielgruppenkriterien | Menschen mit problematischem Alkoholkonsum, d. h. bei Vorliegen von riskanten bzw. hochriskanten Alkoholkonsummustern, die schädlich-missbräuchliche und zum Teil abhängige Diagnoseklassifikationen des ICD-10 und DSM-IV einschließen können. Anmerkung: Eine an die gängigen Krankheitsklassifikationen (ICD-10, DSM IV) angelehnte Diagnose (Missbrauch, Abhängigkeit) wird nicht als Teilnahmebedingung vorausgesetzt, eine selbstständige und anonyme Standortbestimmung im Rahmen des Risikogebrauchskonzepts kann vorgenommen werden. Besonderheit: Im Programm werden Teilnehmer mit unterschiedlichen Zielorientierungen (Nullkonsum vs. gesundheitsverträglicher Konsum) integriert. |
| Ausschlusskriterien | Konsum von Alkohol unmittelbar vor Beginn einer Schulungseinheit |
| Durchführung und Themen | |
| Setting | ambulant |
| Teilnehmerzahl | max. 15 Teilnehmer |
| Anzahl der Einheiten | 9 Einheiten |
| Dauer der Einheiten | 120 Minuten (mit 15-minütiger Pause) |
| Frequenz der Einheiten | Verteilung der 9 Einheiten auf 4-6 Wochen |
| Ziele und Inhalte | |
| Ziele des Programms |
|
| Inhalte |
|
Didaktik und Methoden
| Benutzte Methoden | |
|---|---|
| Methodenliste |
|
| Strukturierungsgrad | |
| Gruppenstruktur | geschlossen |
| (Detailtiefe der Vorgaben, die vom Konzept formuliert werden) | |
| Strukturierungsgrad Methoden | mittel |
| Strukturierungsgrad Zeit | mittel |
| Strukturierungsgrad Struktur | k.A. |
| Einbindung externer Ressourcen | |
| Nachsorgemaßnahmen | k. A. |
| Vorbereitungsmaßnahmen | k. A. |
| Einbezug von Angehörigen | Es wird empfohlen Angehörige vor und nach der Programmdurchführung durch folgende Maßnahmen einzubeziehen:
|
| Maßnahmen zum Alltagstransfer |
|
| Einbezug von Selbsthilfeorganisationen | k. A. |
Rahmenbedingungen
| Angaben zu den Dozent:innen | |
|---|---|
| Dozent:innen | Die Schulung kann von unterschiedlichen Berufsgruppen durchgeführt werden. Eine profunde suchtpsychotherapeutische Qualifikation ist nicht notwendig. |
| Qualifikation des Personals | TTT-Seminare werden von verschiedenen Stellen angeboten. |
| Besonderheiten zum Personal | – |
| Ausstattung und Material | |
| Materialien der Schulung | Alle benötigten Vorlagen für Folien und Arbeitsblätter sind im Manual enthalten. |
| räumliche Voraussetzungen | k. A. |
| Besonderheiten zur Ausstattung | Overheadprojektor; Projektionsfläche; Stellwand zum Schreiben symbolische Repräsentationsformen: Waage mit zwei Schalen (Abbildung im Schulungsprogramm); verschieden geformte und gefärbte Holzklötze; Spielzeugzug mit Lokomotive und Anhänger, auf dem eine Miniaturwaage mit Gewichten montiert ist; Gleisplan auf Stofftuch (Abbildung im Schulungsprogramm) für die Teilnehmer: Schreibmaterialien und Ordner für die Sammlung der Programmmaterialien |
Evaluation und Publikationen
Zusammenfassung der Evaluation
| Quelle |
Wessel, T. & Westermann, H. (2002). Problematischer Alkoholkonsum – Entstehungsdynamik und Ansätze für ein psychoedukatives Schulungsprogramm. Freiburg: Lambertus. Universität Bielefeld – Fakultät Gesundheitswissenschaften |
| Kontext |
Pilotstudie |
| Evaluationsart |
Pilotstudie, extern |
| Design |
Eigen-Warte-Gruppe (quasi-experimentelles Untersuchungsdesign) |
| Stichprobe |
N (Wartezeitraum)= 34
Dropout (Interventionszeitraum): n = 5 N = 27 vollständige Datensätze (Anmerkung: Bei bestimmten Fragestellungen konnten nur 19 Datensätze in die statistische Analyse einbezogen werden.):
|
| Kontrollgruppe |
Interventionszeitraum: Teilnahme am PEGPAK-Programm |
| Gruppenzuweisung |
entfällt, da keine Kontrollgruppe vorhanden |
| Gruppengröße |
s. Stichprobenbeschreibung |
| Katamnese |
|
| Erhebungsinstrumente |
|
| Primäre Zielgrößen |
Wartezeitraum: keine signifikanten Veränderungen in den abhängigen Variablen Interventionszeitraum:
Nachuntersuchungszeitraum:
Angaben zu den verwendeten nonparametrischen Verfahren werden gemacht. Nicht signifikante Ergebnisse werden berichtet. |
| Weitere Zielgrößen |
Es wird nicht zwischen primären und sekundären Zielgrößen unterschieden. |
| Diskussion |
Die Autoren formulieren folgende Einschränkungen bzgl. der Interpretation der Ergebnisse:
|
Train-the-Trainer
| spezifisches TTT vorhanden? | unklar |
Anmerkungen zum gesamten Programm
Stand des Eintrags: 24.06.2010 (redaktionelles Update: November 2023)